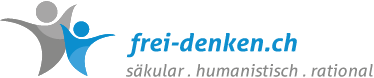“Den Säkularen reicht das Diesseits” – Gastkommentar von Andreas Kyriacou in der NZZ
Am 7. April fragte Urs Hafner in der NZZ woran die Nichtreligiösen glauben – und lieferte gleich selbst Antworten. Diese fielen allerdings eigenartig aus. Die Freidenker bezeichnete er als militant und dogmatisch. Die NZZ bot auf Nachfrage an, in der Rubrik “Meinung und Debatte” eine Replik zu veröffentlichen. Sie erschien am 19. Mai. Anbei der Text in voller Länge.
Den Säkularen reicht das Diesseits
Von Andreas Kyriacou
In der Wochenendbeilage vom 7. April widmete sich die NZZ der Säkularisierung. Bemerkenswerterweise wurde dafür keine Person zu ihrer Weltanschauung befragt, die sich selbst als säkular bezeichnet. Die Beschreibung dieser Gruppe blieb dem Autor Urs Hafner vorbehalten, der einige eigenwillige Annahmen traf. Dieser Beitrag will einige so entstandene Missverständnisse aus dem Weg räumen.
Urs Hafner sinnierte darüber, woran die Religionsdistanzierten glauben, und kam zum Schluss, dass sie nicht einfach nichts glauben. Der Atheist, der auch in der grössten Sinnkrise kein Stossgebet zum Himmel schicke, sei die absolute Ausnahme, und auch eine Person, die sich als konfessionslos oder Agnostikerin bezeichne, könne recht gläubig sein, man müsse nur genauer hinschauen.
Genauer hinschauen sollte man in der Tat. Und das wurde erfreulicherweise auch schon gemacht, so dass wir uns nicht auf Bauchgefühle verlassen müssen. Für die Strukturdatenerhebung 2014 des Bundesamtes für Statistik wurden gut 16’000 Personen zu ihrer Religiosität befragt. Die repräsentativen Ergebnisse zeigen: Religionsferne ist längst Standard. Drei Viertel der Protestanten und 60 Prozent der Katholiken besuchen höchstens fünfmal im Jahr einen Gottesdienst. Bei den unter 35-Jährigen sind gar 80 (Protestanten) beziehungsweise 71 Prozent (Katholiken). Und selbst der privateste religiöse Akt, das Beten, gehört bei vielen Kirchenmitgliedern nicht mehr zum Lebensalltag: Jeder vierte Katholik und jeder dritte Protestant hatte in den letzten zwölf Monaten überhaupt nie gebetet.
Angesichts der Tatsache, dass selbst eingeschriebene Kirchenmitglieder ihr Leben oftmals bestens ohne Gottesdienste und Gebet meistern, mutet es seltsam an, wenn Urs Hafner ausgerechnet den Konfessionslosen eine versteckte Religiosität zuschreiben will. Sie bilden nämlich eine weitaus homogenere Gruppe als die einzelnen Konfessions- und Religionsgruppen: 94 Prozent von ihnen beantworten die Frage, ob sie sich als religiöse Person bezeichnen, mit eher oder klar nein. Die Konfessionslosen gehen als einzige Weltanschauungsgemeinschaft mehrheitlich davon aus, dass es kein Leben nach dem Tod gibt und dass keine höhere Macht unser Schicksal bestimmt. Und sie sind die einzige Gruppe, die klar mehrheitlich der Ansicht ist, dass Religion oder Spiritualität für sie im Umgang mit Krankheiten oder anderen schwierigen Lebenssituationen keine oder keine wichtige Rolle einnehmen.
Zu den Freidenkern, die sich für die Anliegen der Säkularen engagieren, stossen sowohl Personen, die selbst schon immer religionslos waren, wie auch solche, die mit ihrer – meist familiär bedingten – religiösen Vergangenheit brechen. Für sie gilt die konfuzianische Aussage, dass der Mensch zwei Leben hat – das zweite beginnt dann, wenn man merkt, dass man nur eines hat. Die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit befreit, ebenso die Überzeugung, dass keine Götter auf uns einwirken wollen. Es ist ein wunderbarer Ansporn, dem Leben selbst Sinn zu geben. Imaginäre Freunde braucht es dazu wahrlich nicht. Wissenschaft, Kunst, Philosophie, unsere zivilisatorischen Errungenschaften, die Natur und das soziale Umfeld reichen dafür bestens.
Die den Freidenkern im Artikel unterstellte Militanz erläutert Hafner nicht. Ist es das Anbieten weltlicher Rituale, das demokratische Eintreten für mehr Trennung von Staat und Kirche, die Hilfe für verfolgte säkulare Aktivisten in «Gottesstaaten»? Das wissenschaftlich-humanistische Kinderlager Camp Quest? Oder das mehrtägige Wissensfestival Denkfest, das sich in seiner diesjährigen Ausgabe dem Thema «Reformationen des Denkens» annimmt? Mit dieser «Militanz» können wohl auch nicht Interessierte recht entspannt umgehen – was auf religiöse Militanz nicht unbedingt zutrifft.
Andreas Kyriacou ist Präsident der Freidenker-Vereinigung der Schweiz und Berater für Wissensmanagment